Sehen oder nicht sehen...
Jens Bohle
Mal ehrlich, wer
hat sich nicht auch schon über so manchen visuellen Beobachtungsbericht
gewundert, in dem die schwächsten Objekte am Rande der Wahrnehmung erhascht
wurden. Womöglich sieht da ein anderer Beobachter mit einem kleineren Scope
mehr als man selbst. Da kommen einem schon gewisse Zweifel... Die sind sicher
berechtigt, aber Beobachtung ist eben nicht gleich Beobachtung. Also woran liegt
es, dass einige Sternengucker mehr sehen als andere? Es gibt einige Faktoren,
die solche "Ungereimtheiten" (ich nenne es mal so) zustande kommen lassen. Ich
möchte hier keine Anleitung zur Beobachtung geben, jedoch versuche
ich zu erklären, woran es liegen kann, dass die Beobachtungsergebnisse
teilweise sehr unterschiedlich ausfallen.
 Zunächst
muss man die Bedingungen vor Ort (bzw. am Himmel) ermitteln. Man könnte eine
grobe Einteilung wie etwa Stadthimmel, Landhimmel oder Alpenhimmel festlegen,
doch dies ist sehr ungenau zumal sich diese Einteilungen auch überschneiden können.
Aussagekräftiger ist die sogenannte fst-Bestimmung (fst = faintest star). Sie
bestimmt die Helligkeit, des schwächsten mit bloßem Auge sichtbaren Sterns.
Aber diese Bestimmung ist auch subjektiv. Als Beispiel: Der unerfahrene
Sternfreund sieht am Beobachtungsort Sterne bis 5,5mag mit bloßem Auge. Der
erfahrenere Beobachter erkennt an diesem Abend am gleichen Beobachtungsplatz
hingegen Sterne bis 6,5mag oder mehr (selbst erlebt). Da liegt schon mal eine
"kleine Welt" dazwischen wenn es gilt die Beobachtungsbedingungen zu
beschreiben. Außerdem gilt hier zu definieren, wann ein Stern als gesehen
eingestuft wird. Ich sehe einen Stern, wenn er sich bei indirektem Sehen auf
meiner Netzhaut mehrmals abbildet- andere Beobachter definieren Sehen vielleicht
anders; vielleicht die dauernde direkte visuelle Erfassung des angepeilten
Sterns ohne lange hinschauen zu müssen. Allerdings muss man auch ehrlich zu
sich selbst sein, denn ein x-mal angepeilter Stern, dessen Helligkeit und
Position man schon aus dem "FF" kennt, lässt sich nun mal leichter
sichten als ein weniger "frequentierter" Stern. Ebenso kommt es
darauf an, in welchem Himmelsareal die fst-Bestimmung durchgeführt wird. Im
Zenit, im
zirkompularen Sternbild Kleiner Bär (Polsequenz) oder im zu
beobachtenden Areal (Sternbild). Auch da können schon Differenzen auftreten und
ein
Zunächst
muss man die Bedingungen vor Ort (bzw. am Himmel) ermitteln. Man könnte eine
grobe Einteilung wie etwa Stadthimmel, Landhimmel oder Alpenhimmel festlegen,
doch dies ist sehr ungenau zumal sich diese Einteilungen auch überschneiden können.
Aussagekräftiger ist die sogenannte fst-Bestimmung (fst = faintest star). Sie
bestimmt die Helligkeit, des schwächsten mit bloßem Auge sichtbaren Sterns.
Aber diese Bestimmung ist auch subjektiv. Als Beispiel: Der unerfahrene
Sternfreund sieht am Beobachtungsort Sterne bis 5,5mag mit bloßem Auge. Der
erfahrenere Beobachter erkennt an diesem Abend am gleichen Beobachtungsplatz
hingegen Sterne bis 6,5mag oder mehr (selbst erlebt). Da liegt schon mal eine
"kleine Welt" dazwischen wenn es gilt die Beobachtungsbedingungen zu
beschreiben. Außerdem gilt hier zu definieren, wann ein Stern als gesehen
eingestuft wird. Ich sehe einen Stern, wenn er sich bei indirektem Sehen auf
meiner Netzhaut mehrmals abbildet- andere Beobachter definieren Sehen vielleicht
anders; vielleicht die dauernde direkte visuelle Erfassung des angepeilten
Sterns ohne lange hinschauen zu müssen. Allerdings muss man auch ehrlich zu
sich selbst sein, denn ein x-mal angepeilter Stern, dessen Helligkeit und
Position man schon aus dem "FF" kennt, lässt sich nun mal leichter
sichten als ein weniger "frequentierter" Stern. Ebenso kommt es
darauf an, in welchem Himmelsareal die fst-Bestimmung durchgeführt wird. Im
Zenit, im
zirkompularen Sternbild Kleiner Bär (Polsequenz) oder im zu
beobachtenden Areal (Sternbild). Auch da können schon Differenzen auftreten und
ein
 und die selbe Nacht kann bezüglich Himmelsqualität völlig
unterschiedlich
bewertet werden.
Sinnvoll ist natürlich die Bestimmung im dem zu beobachtenden
Himmelsausschnitt. So kann es nicht zu Missverständnissen bei Schilderungen
kommen und gemachte Beobachtungen lassen sich besser vergleichen. Etwas
objektiver ist die mittlerweile etablierte Methode der Messung der
Himmelshelligkeit mittels Messgerät (Sky Quality Meter
und die selbe Nacht kann bezüglich Himmelsqualität völlig
unterschiedlich
bewertet werden.
Sinnvoll ist natürlich die Bestimmung im dem zu beobachtenden
Himmelsausschnitt. So kann es nicht zu Missverständnissen bei Schilderungen
kommen und gemachte Beobachtungen lassen sich besser vergleichen. Etwas
objektiver ist die mittlerweile etablierte Methode der Messung der
Himmelshelligkeit mittels Messgerät (Sky Quality Meter
Das
Instrumentarium
 Das verwendete Instrumentarium kommt als Faktor auch ins Spiel. Z. B. ist ein 8
Zoll Newton sind nicht gleich ein 8 Zoll Newton. Unterschiedliche
Spiegelqualitäten (Oberflächengenauigkeit bzw. Reflektionsgrad der
Verspiegelung) können schon zu verschiedenen Ergebnissen führen. Auch im Deep
Sky- Bereich möchte ich gerade bei Beobachtungen im min AP Bereich (höchste
Vergrößerung), eine gute Oberflächenqualität der Spiegel nicht missen
(Spiegel als billige Lichtsammler... ein alter Hut). Schlechte Teleskopoptiken
zeigen ein verschmiertes Bild wo mit einer guten Optik noch Abstufungen im
Kontrast, also feinste Details, zu erkennen sind. Auch die Okularwahl bringt
unterschiedliche Ergebnisse. Das werden die Planetenbeobachter bestätigen können,
denn sie vertrauen möglichst einfach aufgebauten Okulartypen um ein Maximum an
Transmission und Schärfe zu erlangen. So konnte ich bei einer Beobachtung einer
schwachen Galaxie (~14mag) mit einem 20cm Teleskop die Sichtung nur in einem
Okulartyp bestätigen. Das andere Okular mit höheren Transmissionsverlusten
zeigte das Objekt eindeutig nicht! Eine entspannter Einblick ins Okular kann das
"Sehergebnis" auch enorm beeinflussen. Noch wichtiger ist die exakte
Justierung des Fernrohrs. Mit einem dejustierten Scope wird man eben nicht
soviel erkennen, wie mit einem ordentlich justierten Teleskop. Die Justage
sollte also genau möglichst stabil sein. Ein weiteres bestimmendes Moment,
welches gemachte Beobachtungen nicht un- bedingt vergleichbar macht, ist
folgendes: Ist das Scope ein Dobson (also azimutal montiert), oder ist es
parallaktisch montiert? Das ist ein enormer Unterschied, von dem ich mich erst
selbst überzeugen lassen musste! Nach meinen bisherigen Erkenntnissen sieht man
im min AP- Bereich (Maximalvergrößerung) z.B. mit einem parallaktisch
(also motorisch) nachgeführten 16 Zoll Teleskop mehr, als in einem azimutal
montierten 20 Zoll Teleskop! Dies gilt besonders, wenn man Eindrücke am
Teleskop zeichnerisch dokumentiert. Auch die mechanische Stabilität kann
Wahrnehmungen beeinflussen. Ein schlecht nach- zuführendes Teleskop (ruckeln
oder wackeln) kann kein entspanntes beobachten ermöglichen.
Das verwendete Instrumentarium kommt als Faktor auch ins Spiel. Z. B. ist ein 8
Zoll Newton sind nicht gleich ein 8 Zoll Newton. Unterschiedliche
Spiegelqualitäten (Oberflächengenauigkeit bzw. Reflektionsgrad der
Verspiegelung) können schon zu verschiedenen Ergebnissen führen. Auch im Deep
Sky- Bereich möchte ich gerade bei Beobachtungen im min AP Bereich (höchste
Vergrößerung), eine gute Oberflächenqualität der Spiegel nicht missen
(Spiegel als billige Lichtsammler... ein alter Hut). Schlechte Teleskopoptiken
zeigen ein verschmiertes Bild wo mit einer guten Optik noch Abstufungen im
Kontrast, also feinste Details, zu erkennen sind. Auch die Okularwahl bringt
unterschiedliche Ergebnisse. Das werden die Planetenbeobachter bestätigen können,
denn sie vertrauen möglichst einfach aufgebauten Okulartypen um ein Maximum an
Transmission und Schärfe zu erlangen. So konnte ich bei einer Beobachtung einer
schwachen Galaxie (~14mag) mit einem 20cm Teleskop die Sichtung nur in einem
Okulartyp bestätigen. Das andere Okular mit höheren Transmissionsverlusten
zeigte das Objekt eindeutig nicht! Eine entspannter Einblick ins Okular kann das
"Sehergebnis" auch enorm beeinflussen. Noch wichtiger ist die exakte
Justierung des Fernrohrs. Mit einem dejustierten Scope wird man eben nicht
soviel erkennen, wie mit einem ordentlich justierten Teleskop. Die Justage
sollte also genau möglichst stabil sein. Ein weiteres bestimmendes Moment,
welches gemachte Beobachtungen nicht un- bedingt vergleichbar macht, ist
folgendes: Ist das Scope ein Dobson (also azimutal montiert), oder ist es
parallaktisch montiert? Das ist ein enormer Unterschied, von dem ich mich erst
selbst überzeugen lassen musste! Nach meinen bisherigen Erkenntnissen sieht man
im min AP- Bereich (Maximalvergrößerung) z.B. mit einem parallaktisch
(also motorisch) nachgeführten 16 Zoll Teleskop mehr, als in einem azimutal
montierten 20 Zoll Teleskop! Dies gilt besonders, wenn man Eindrücke am
Teleskop zeichnerisch dokumentiert. Auch die mechanische Stabilität kann
Wahrnehmungen beeinflussen. Ein schlecht nach- zuführendes Teleskop (ruckeln
oder wackeln) kann kein entspanntes beobachten ermöglichen.
Der
physische Faktor
 Dann
ist es auch wichtig, wie man sich im Moment der Beobachtung fühlt. Ist man
ausgeschlafen oder hat man die Nacht zuvor auch schon ausgiebig beobachtet? Hat
man am Morgen zuvor ausgeschlafen oder hat man vielleicht einen anstrengenden
Arbeits- oder Schultag hinter sich? Des weiteren: Wann wurde die Beobachtung
durchgeführt- in der ersten oder zweiten Nachthälfte? Mit fortschreitender
Stunde lässt die Aufmerksamkeit nach (mein Tipp: regelmäßige Pausen während
der Beobachtungsnacht). Ein "frischer" Beobachter ist einem müden
oder leicht erschöpften Sternengucker um einiges voraus (ganz besonders bei
anstrengen Beobachtungen im Limitbereich). Die Aufmerksamkeit lässt auch bei
Minusgraden nach (vor allem wenn man schon kalte Füße hat!). Dann kommt es
darauf an, ob man während der Beobachtung sitzt oder steht. Sitzen ist
wesentlich entspannter. So kann man länger unverkrampft nach dem Objekt suchen
bzw. es betrachten. Wer einmal länger auf einer Leitersprosse stehend,
verzweifelt nach einem Objekt gesucht hat, weiß wovon ich rede...
Dann
ist es auch wichtig, wie man sich im Moment der Beobachtung fühlt. Ist man
ausgeschlafen oder hat man die Nacht zuvor auch schon ausgiebig beobachtet? Hat
man am Morgen zuvor ausgeschlafen oder hat man vielleicht einen anstrengenden
Arbeits- oder Schultag hinter sich? Des weiteren: Wann wurde die Beobachtung
durchgeführt- in der ersten oder zweiten Nachthälfte? Mit fortschreitender
Stunde lässt die Aufmerksamkeit nach (mein Tipp: regelmäßige Pausen während
der Beobachtungsnacht). Ein "frischer" Beobachter ist einem müden
oder leicht erschöpften Sternengucker um einiges voraus (ganz besonders bei
anstrengen Beobachtungen im Limitbereich). Die Aufmerksamkeit lässt auch bei
Minusgraden nach (vor allem wenn man schon kalte Füße hat!). Dann kommt es
darauf an, ob man während der Beobachtung sitzt oder steht. Sitzen ist
wesentlich entspannter. So kann man länger unverkrampft nach dem Objekt suchen
bzw. es betrachten. Wer einmal länger auf einer Leitersprosse stehend,
verzweifelt nach einem Objekt gesucht hat, weiß wovon ich rede...
Andere beeinflussende Faktoren sind
eventueller Alkohol- oder Nikotingenuss vor der Beobachtung. Das macht viel aus.
Ich bin mir sicher, dass eine gute körperliche Fitness und der Verzicht von
Nikotin/Alkohol oder Kaffee (zumindest während oder vor der Beobachtung) mehr
Wahrnehmung beschert.
Die Beobachtungserfahrung
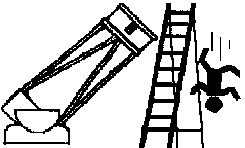 Nun
kommt der Punkt, der sich für mich am schwierigsten in Worte fassen lässt: Die
Beobachtungserfahrung. Schon bei der Beobachtungstechnik am Fernrohr machen sich
ebenfalls Unterschiede in den Ergebnissen bemerkbar. Z. B. kann ausgiebiges
experimentieren mit Vergrößerungen zum Beobachtungserfolg führen, im Nachteil
ist derjenige, der die jeweiligen Seeingverhältnisse nicht der teleskopischen
Leistung anpasst. Ein weiterer Faktor ist die Dunkeladaption. Hier werden
erfahrungsgemäß auch unterschiedliche Maßstäbe angesetzt. Um in den
Grenzbereich zu gehen und eben alles an Informationen "aufzusaugen",
sollte man auf jegliche Beleuchtung verzichten (auch keine rote Taschenlampe!).
Nur dann kann sich das Auge für die schwächsten Objekte öffnen. Extrafoveales
(indirektes) sehen oder "field sweeping" auch "scope swinging"
(leichtes bewegen des Fernrohrs) genannt, sind nicht Jedermann/Frau vertraut. So
kann es schon wieder zu gravierenden Differenzen bei den Beobachtungsergebnissen
kommen. Ein erfahrener Beobachter wendet diese Techniken automatisch an und ist
damit im Vorteil. Etwas ernüchternd mag für manchen Sternfreund die
visuelle Beschreibung einiger Himmelsobjekte sein. Da wird von "gleißend
hell", "easy viewing" oder "leicht machbar" etc.
gesprochen. Man selbst hat diese Objekte aber ganz anders erlebt. Als Erklärung
vielleicht folgendes Beispiel: Stell dir, vor du sitzt das erste mal in einem
Ferrari und spurtest mit Tempo 280 über die Autobahn- ein Wahnsinnstempo. Fragt
man den professionellen Rennfahrer, wird er über dieses Tempo vielleicht nur müde
lächeln. "280km/h- und das nur gerade aus? - "leicht machbar".
Ebenso verhält es sich bei der visuellen Beobachtung. Nur wer schon die Grenzen
der eigenen Wahrnehmung erfasst hat, kann weitere Beobachtungen taxieren. Man
weiß dann z. B. wie eine 14mag Galaxie im 8 Zöller aussieht und könnte dann
eine 13mag Galaxie als hell bezeichnen. Derjenige, der eine 13mag Galaxie in
einem solchen Teleskop erstmals sieht, würde diese Galaxie als schwach
bezeichnen. Kurz: Viele Beobachtungen unterschiedlichster Objekte
erlauben das relativieren der gesammelten Eindrücke- nur so kann man sich ein
Urteil bilden. Die genannten Punkte gelten ganz besonders, wenn man an die
Grenzen der Machbarkeit vordringen will, sei es ein Objekt überhaupt zu sehen
oder Details in einem schon aufgefundenen Objekt zu erkennen. Dann gewinnt die
Quantifizierung der
Nun
kommt der Punkt, der sich für mich am schwierigsten in Worte fassen lässt: Die
Beobachtungserfahrung. Schon bei der Beobachtungstechnik am Fernrohr machen sich
ebenfalls Unterschiede in den Ergebnissen bemerkbar. Z. B. kann ausgiebiges
experimentieren mit Vergrößerungen zum Beobachtungserfolg führen, im Nachteil
ist derjenige, der die jeweiligen Seeingverhältnisse nicht der teleskopischen
Leistung anpasst. Ein weiterer Faktor ist die Dunkeladaption. Hier werden
erfahrungsgemäß auch unterschiedliche Maßstäbe angesetzt. Um in den
Grenzbereich zu gehen und eben alles an Informationen "aufzusaugen",
sollte man auf jegliche Beleuchtung verzichten (auch keine rote Taschenlampe!).
Nur dann kann sich das Auge für die schwächsten Objekte öffnen. Extrafoveales
(indirektes) sehen oder "field sweeping" auch "scope swinging"
(leichtes bewegen des Fernrohrs) genannt, sind nicht Jedermann/Frau vertraut. So
kann es schon wieder zu gravierenden Differenzen bei den Beobachtungsergebnissen
kommen. Ein erfahrener Beobachter wendet diese Techniken automatisch an und ist
damit im Vorteil. Etwas ernüchternd mag für manchen Sternfreund die
visuelle Beschreibung einiger Himmelsobjekte sein. Da wird von "gleißend
hell", "easy viewing" oder "leicht machbar" etc.
gesprochen. Man selbst hat diese Objekte aber ganz anders erlebt. Als Erklärung
vielleicht folgendes Beispiel: Stell dir, vor du sitzt das erste mal in einem
Ferrari und spurtest mit Tempo 280 über die Autobahn- ein Wahnsinnstempo. Fragt
man den professionellen Rennfahrer, wird er über dieses Tempo vielleicht nur müde
lächeln. "280km/h- und das nur gerade aus? - "leicht machbar".
Ebenso verhält es sich bei der visuellen Beobachtung. Nur wer schon die Grenzen
der eigenen Wahrnehmung erfasst hat, kann weitere Beobachtungen taxieren. Man
weiß dann z. B. wie eine 14mag Galaxie im 8 Zöller aussieht und könnte dann
eine 13mag Galaxie als hell bezeichnen. Derjenige, der eine 13mag Galaxie in
einem solchen Teleskop erstmals sieht, würde diese Galaxie als schwach
bezeichnen. Kurz: Viele Beobachtungen unterschiedlichster Objekte
erlauben das relativieren der gesammelten Eindrücke- nur so kann man sich ein
Urteil bilden. Die genannten Punkte gelten ganz besonders, wenn man an die
Grenzen der Machbarkeit vordringen will, sei es ein Objekt überhaupt zu sehen
oder Details in einem schon aufgefundenen Objekt zu erkennen. Dann gewinnt die
Quantifizierung der
Resümee
Das Konglomerat aus all diesen Faktoren erklärt meiner Meinung nach die teilweise stark unterschiedlichen Ergebnisse der visuellen Deep Sky- Beobachtungen. Aber auch wenn der eine Sternfreund mehr sieht als der andere, den Spaß bei der Beobachtung von Himmelsobjekten sollte dies keinen Abbruch tun!